Anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25.11.25, schreibt Asha Hedayati einen Brief an eine Mandantin. Sie zeigt, wie Frauen* nicht an einzelnen Tätern scheitern, sondern an einer Gesellschaft, die Sicherheit nicht als Verantwortung und Fürsorge versteht, sondern Gewalt reproduziert. Unsicherheit entsteht dort, wo Neutralität die Täter schützt – und nicht die Betroffenen.
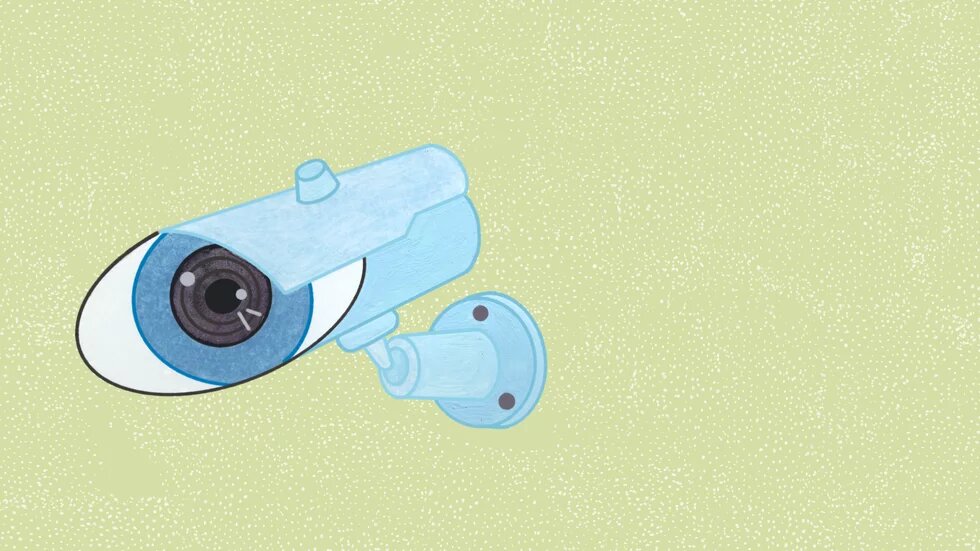
Ich erinnere mich an Sie, Frau M. Sie saßen in meinem Büro und waren müde: „Ich will nur, dass es aufhört.“ Ich sah auf das Formular, das Sie ausgefüllt hatten: Gewaltschutzverfahren, Sorge, Umgang, Tochter 8 Jahre alt. Ich machte Anmerkungen mit sachlichen Strichen. Sie erzählten von Ihrem Ex-Partner, der ihnen jahrelang Gewalt angetan hatte, von dem Sie sich mit viel Mühe getrennt haben, der Sie seitdem nicht in Ruhe lasse. Sie hatten Angst vor ihm, weil er schon damit gedroht hat, Ihnen das Leben zur Hölle zu machen, wenn Sie sich von ihm trennen sollten. Sie erzählten von Nächten, in denen er vor der Tür stand, nicht laut, nur anwesend. Von Nachrichten, in denen er forderte, Sie müssten „vernünftig“ bleiben, weil das „Kind ja beide Eltern brauche“. Dass Sie sich lange nicht trennen konnten, weil Sie die Sorge hatten, Ihre Familie allein nicht finanzieren zu können, keine eigene Wohnung zu finden.
Ich antwortete mit den Sätzen, die man in so einer Lage sagt: „Wir beantragen eine Verfügung. Er darf sich Ihnen dann nicht mehr nähern, keinen Kontakt mehr aufnehmen. Sie müssen keine Angst haben.“ Sie nickten. Aber ich sah an Ihrer Haltung, dass es nicht stimmte. Das Familiengericht entschied schnell. Das Näherungsverbot wurde erlassen, befristet auf sechs Monate. Danach müsse die Lage neu bewertet werden. Das Gericht prüfte parallel das Umgangsrecht. Die Richterin sagte: „Das Kind hat ein Recht auf Kontakt mit beiden Elternteilen.“ Sie sprach in der Sprache der „Ausgewogenheit“. Ich verstand damals noch nicht, dass diese Sprache das Gegenteil von Schutz war. Nach der Verhandlung sagten Sie: „Ich will, dass unser Kind einen Vater hat, aber ich will, dass es gesund bleibt, dass es sich nicht zu fürchten braucht.“ Das Jugendamt drängte im gerichtlichen Verfahren auf gemeinsame Gespräche, sprach von „Kooperationsbereitschaft“. In jedem Schreiben ein Hinweis auf das Kindeswohl, aber nirgends ein Satz darüber, was Gewalt mit einer Familie, einem Kind macht.
Strukturen, die Gewalt möglich machen
Jahre habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass Sie nicht an einem Täter gescheitert sind, sondern an den Strukturen, die seine Gewalt möglich machten. Das Recht behauptet Neutralität. Aber Neutralität ist in ungleichen Strukturen eine Form der Parteinahme. Sie schützt die Ordnung, nicht die, die in ihr verletzt wurden.
Sicherheit, so dachte ich früher, entsteht durch Gesetze. Heute weiß ich: Gesetze definieren Zuständigkeiten, keine Rettung.
Sicherheit darf nicht erst im Gerichtsverfahren, sondern muss im Leben davor hergestellt werden.
Sicherheit hätte bedeutet, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, damit Sie sich hätten früher trennen und ausziehen können. Dass das Jugendamt Ihre Tochter ernst nimmt und Ihnen Unterstützung anbietet. Dass Sie ein Leben ohne ihren gewalttätigen Ex-Partner führen könnten, ohne zu verarmen. Ich wünschte, Sie hätten eine Gesellschaft gehabt, die Ihnen geglaubt hätte, bevor die Gewalt eskalierte. Aber wir leben in einem Land, das lieber kontrolliert als zuzuhören und zu verstehen. Ich erinnere mich an die Anhörung, in der Ihr Ex-Partner forderte, das Kind wieder regelmäßig sehen zu dürfen. Er wirkte ruhig, gepflegt, höflich. Das Protokoll nennt ihn „kooperativ“. Sie hingegen: „aufgebracht, emotional“.
Ich denke oft daran, wie Gewalt aussieht, wenn man sie durch die Sprache des Gerichts filtert: aus Bedrohung wird „Hochstrittigkeit“, aus Angst „Blockadehaltung“. Ich habe gesehen, wie Mütter ihre Kinder verloren, weil sie Schutz suchten. Ich habe gesehen, wie Frauen sich beleidigen ließen, um nicht als „unkooperativ“ zu gelten. Ich habe gesehen, wie Richterinnen und Gutachterinnen mit wohlklingenden Begriffen die Gewalt des Ex-Partners fortsetzten: Bindungstoleranz, einvernehmliche Lösung für die Zukunft, Kindeswohl. Aber in Wahrheit meinten sie Gehorsam und Anpassung an die Normalität der Gewalt. Die Wahrheit ist: Unser Familienrecht geht davon aus, dass Eltern gleichgestellt sind, auf Augenhöhe agieren, wohlwollend und gut miteinander umgehen.
Die Realität sieht anders aus. Es gibt Abhängigkeit, Armut, Krankheit, Gewalt, und das strukturell in der Regel zu Lasten der Frau.
Das Gericht verwaltet den Konflikt, anstatt seine Ursachen politisch zu begreifen. Ich frage mich oft, ob irgendjemand im Gerichtssaal das Wort Liebe und Fürsorge gedacht hat. Nicht romantisch, – sondern als soziale Praxis, als Arbeit am Leben. Vielleicht wäre alles anders, wenn Liebe wieder als Verantwortung begriffen würde, nicht als Privatsache. Wenn Fürsorge als politische Aufgabe verstanden würde.
Kürzungen im Gewaltschutzbereich und bei der Prävention – welche Sicherheit ist gemeint?
Und während die politischen Entscheidungsträger*innen weiter im Gewaltschutzbereich und bei der Prävention kürzen, führen sie gleichzeitig die nächste Sicherheitsdebatte. Man benutzt Frauen wie Sie, um ein anderes Feindbild zu konstruieren. „Wir müssen Frauen besser schützen!“, heißt es, und gemeint ist: „Wir müssen Grenzen schließen.“ Man redet über Gewalt, aber meint Migration. Als wäre Sicherheit eine nationale, nicht eine soziale Angelegenheit. Als ginge es um Kultur, nicht um Strukturen.
Ich höre: Härtere Strafen, mehr Polizei, mehr Abschiebungen. Ich denke an die vielen marginalisierten Betroffenen, die Täter-Opfer-Umkehr durch die Polizei erfahren, an die vielen Verletzten und Toten durch Polizeigewalt.1 Bei der politischen Debatte über die Sicherheit von Frauen wird fast ausschließlich die Sicherheit im öffentlichen Raum gemeint. Es geht dann um dunkle Parks, Frauenabteile, mehr Überwachungsmaßnahmen.
Die Konstruktion des gefährlichen öffentlichen Raums ist direkt mit der Rassifizierung der Gefahr verbunden, denn mit Gefahr sind damit nicht alle Männer gemeint, sondern insbesondere „der Fremde“.
Der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch ihr eigenes Zuhause ist und die Sicherheit in (Ex-)Beziehungen, in der Familie und im sozialen Nahbereich fehlt. Dies anzuerkennen, würde bedeuten, dass die Lösungen nicht durch rassistische Debatten um Abschiebungen und Grenzschließungen gefunden werden können, sondern komplexer sein müssen: Sie müssen in die Gesellschaft hineinwirken und sie von innen heraus verändern.
Strukturen sozialer Ungleichheit als Nährboden von Gewalt
Ich habe mir manchmal vorgestellt, was Sie gesagt hätten, wenn Sie noch einmal gekommen wären. Vielleicht hätten Sie gefragt, warum niemand Verantwortung übernimmt. Vielleicht hätten Sie geschwiegen. Oder Sie hätten, ganz leise wieder gesagt: „Ich will nur, dass es aufhört.“ Heute weiß ich, dass dieser Satz alles enthält, was Politik sein müsste. Eer sagt: Ich will leben. Ich will Teil haben. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will frei sein. Darin liegt das eigentliche Sicherheitsversprechen, das der Staat permanent bricht.
Ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil Sie mir beibrachten, was Neutralität anrichtet. Wie man trotz eines juristisch korrekten Verfahrens Gewalt erfahren kann. Wenn ich ehrlich bin, schreibe ich diesen Brief auch, um mich selbst zu erinnern, dass das, was wir „Fall“ nennen, ein Mensch ist.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Deutschland werden durchschnittlich 15 Frauen pro Stunde Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und das ist nur das Hellfeld. Das Dunkelfeld wird deutlich größer sein. Diese Zahlen sind nicht nur Ausdruck individueller Täter, sondern auch gesellschaftlicher Bedingungen: Soziale Ungleichheit, fehlende Ressourcen, Prekariat und Ausbeutung. Es sind diese Strukturen, die Gewalt ermöglichen und reproduzieren.
Denn Gewalt entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Land, das Frauen immer wieder in Abhängigkeiten zwingt: ökonomisch, sozial, emotional. Migrantische Frauen, geflüchtete Frauen, Frauen mit Behinderungen, trans Frauen – sie sind besonders betroffen, weil sie zusätzliche Barrieren und Diskriminierungen erleben.
Sicherheit als Fürsorge, Gerechtigkeit und Freiheit
Sicherheit entsteht dort, wo alle diese marginalisierten Betroffenen Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnraum haben, wo sie Unterstützung erfahren und nicht allein gelassen werden.
Sicherheit ist die Gewissheit, dass man gehört wird, dass einem geglaubt wird, dass man Schutz bekommt – nicht erst, wenn die Gewalt eskaliert.
Manchmal, wenn ich Akten schließe, stelle ich mir vor, dass aus diesen Papieren irgendwann etwas wächst: eine andere Art, Recht zu verstehen, Fürsorge zu üben, Sicherheit zu denken. Vielleicht werden diese Geschichten eines Tages nicht mehr nur als Fälle besprochen, sondern als Anfang eines anderen Denkens – eines, das Leben über Ordnung, Verfahren und Vorschriften stellt. Ich schreibe diesen Brief, damit Sie darin nicht enden, sondern fortwirken – in der Wut, im Bewusstsein, in der Möglichkeit, dass wir Gerechtigkeit neu erfinden. Und ich schreibe diesen Brief, weil ich möchte, dass Ihre Geschichte nicht nur als Einzelfall erzählt wird, sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Als Teil eines Kampfes für eine Gesellschaft, in der Sicherheit für alle gilt. Eine Gesellschaft, die Fürsorge als politische, kollektive Aufgabe begreift und strukturelle Gewalt ernst nimmt. Ich hoffe, dass Ihr Kind eines Tages in einer solchen Welt leben kann. Vielleicht, Frau M., ist es das, was Hoffnung wirklich ist: das Weiterwirken Ihrer Geschichte, die dazu beiträgt, diese Welt zu schaffen. Sicherheit, die auf Fürsorge, Gerechtigkeit und Freiheit beruht, ist möglich.
Der Artikel erschien in gekürzter Form bei der Freitag